
Der Geschmack von Laub und Erde – Rezension
In diesem ungewöhnlichen Buch versucht ein englischer Tierarzt das Menschsein hinter sich zu lassen – um in einem Erdwall zu hausen wie ein Dachs und in Mülltonnen zu wühlen wie ein Großstadtfuchs.
(Zum) „Tier-Werden“ – während meines Studiums hab ich viel darüber erfahren, was sich sich die Liga der Kontinentalphilosophen darunter vorstellte: zum Beispiel eine intellektuelle Methode, ein Anders-Werden der Welt, ein Verlassen ausgetretener dichotomer Pfade. Tatsächliche Tiere aus Fleisch und Blut spielten hier selten eine Rolle (mal abgesehen von Derridas kleiner Kätzin vielleicht).
Tatsächliche Tiere sind auch ein schwieriges Ziel, den Menschen können wir ja nun nicht ablegen. Und trotzdem hat Charles Foster, seines Zeichens Tierarzt, Anwalt und Dozent für Ethik, genau das versucht. „Der Geschmack von Laub und Erde“ beginnt mit dem abenteuerlichen Satz: „Ich wollte wissen, wie es ist, ein Wildtier zu sein.“ Und dafür musste er eben eines werden. Am besten gleich fünf! In griechisch-antiker Tradition wählt er nach Elementen aus: Dachs und Rothirsch für die Erde, Otter für das Wasser, Mauersegler für die Luft und Fuchs für das Feuer.

Fosters Interesse an anderen Tieren beginnt in der frühsten Kindheit. Nicht etwa auf einem Bauernhofidyll umringt von freundlichen Haustieren, sondern umgeben von Tierpräparaten, die er unermüdlich anfertigt und in seinem Zimmer aufstellt. Der Wunsch, dem mysteriösen Mauersegler in den Kopf gucken zu können, zu verstehen, was und wie er denkt, das treibt ihn an – und nicht selten zur Verzweiflung. Eine fehlgeleitete Naturverbundenheit gepaart mit kruden Männlichkeitsvorstellungen machen aus ihm später zunächst einen mittel-passionierten Jäger. Bis der Jäger zur gehetzten Hirschkuh werden kann, gehen schließlich noch ein paar Jahre ins Land. Das Kapitel über jene Zeit gehört allerdings zu meinen liebsten, denn es erklärt das gedankliche System in dem der Jäger jagt, und leitet dann schmerzhaft genau einen perspektivischen Wechsel ein.
Wie aber wird man nun ein Wildtier?
Ausgangspunkt seiner exzentrischen Unternehmungen ist immer die „gemeinsame Sprache“: neurologische Gemeinsamkeiten, „summende Neuronen“ und Sinneseindrücke. Zwar nehmen wir diese in unterschiedlichsten Graden wahr und jeder Sinnesneindruck bedeutet für den Dachs und den Mauersegler etwas gänzlich anderes. Trotzdem riechen wir dasselbe Bingelkraut, hören denselben Fasan. Das wir bestimmte Eindrücke mit anderen – Tieren oder Menschen – teilen, das ist ein Glaube, an dem Foster festhält. Unsere physiologische Ähnlichkeit soll stärker zutage treten, wenn wir uns im selben Raum befinden, weshalb Foster monatelang in Erdwällen lebt, ohne Obdach in der Großstadt rumlungert und am Grund kalter Flüsse liegt.
Denn, „Tiere sind aus dem Land hervorgegangen“ – ein Bild das mir besonders gut gefällt. Die Verbundenheit, die einige Tiere mit Land und Erde hegen, ist einigen anderen (uns!) oft verloren gegangen, aus durchaus praktischen und teilweise einleuchtenden Gründen. Die Faszination für die faktische Regionalität der Wildtiere („Beinahe jedes Molekül eines typischen Dachses stammt aus einem Umkreis von sechzig Hektar um den Bau“) kann ich gut nachvollziehen, denn sie ist dadurch stets ökologisch – alle Handlungen, alle Faktoren, das Leben und das Sterben an einem Ort, greifen ineinander.
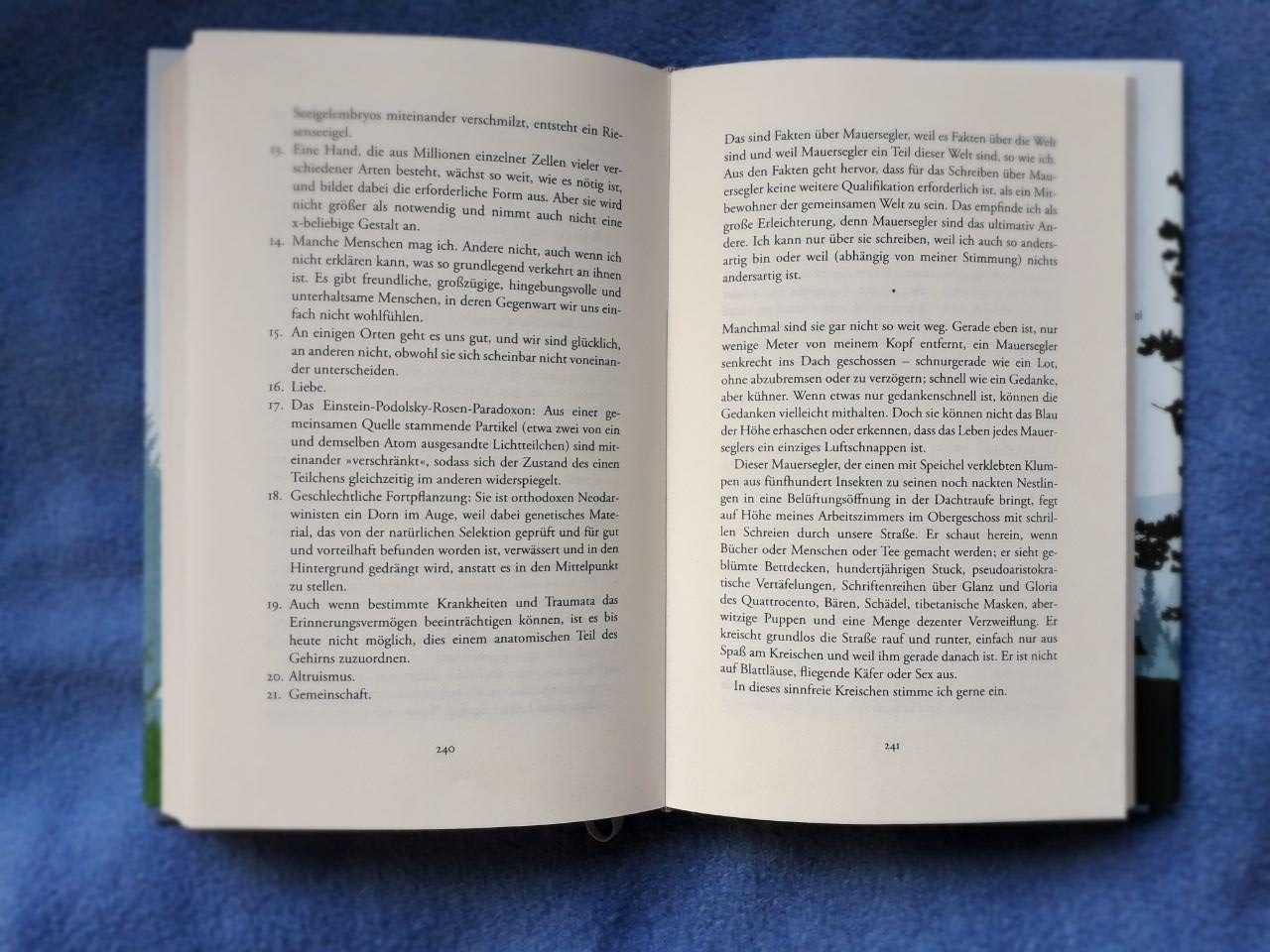
Auch auf kulinarischer Ebene geht es übrigens um Regionalität. Foster, zu diesem Zeitpunkt halb Dachs, halb Sommelier, erschmeckt feine Unterschiede:
„Regenwürmer schmecken nach Schleim und der Erde, aus der sie kommen. Sie sind der Inbegriff eines regionalen Nahrungsmittels und haben, wie Weinkenner sagen würden, ein sehr ausgeprägtes Terroir.(…)Der Wurm aus Chablis hat einen langen, mineralischen Abgang. Sein Artgenosse aus der Picardie schmeckt muffig, nach Fäulnis und gesplittertem Holz. Würmer aus dem High Weald von Kent schmecken frisch und schnörkellos.“
Das Buch macht aber lange nicht Halt an kulinarischen Reizverarbeitungsprozessen und anderen neurologischen Fakten (obwohl man hier schon ganz viel lernen kann: Dachse hören mit den Pfoten! Otter verschlafen dreiviertel ihres Lebens und rasten in der restlichen Zeit stoffwechselmäßig völlig aus! Mauersegler landen zehn Monate lang GAR NICHT!). Zur leicht romantisierten Suche nach wilder Andersartigkeit gesellen sich wunderbare Geschichten, Allegorien und Selbstreflexionen. Die Art und Weise dieses oft selbstironischen, klugen & poetischen Buchs macht seinen Reiz aus – die Grenzen zwischen Sachbuch, Selbstfindungstrip, Fiktion und pragmatischem Faktenwissen sind genauso fließend, wie die zwischen Mensch und Tier.
„Aber Artengrenzen sind, wenn nicht illusionär, so doch zumindest vage und manchmal auch durchlässig. Das kann Ihnen jeder Evolutionsbiologe und jeder Schamane bestätigen. Es ist kaum dreißig Millionen Jahre her – gerade ein sachter Lidschlag in der Existenz unseres Planeten, auf dem sich vor 3,4 Milliarden Jahren Leben entwickelt hat – dass die Dacshe und ich gemeinsame Vorfahren hatten.(…) Alle Tiere mit denen ich mich in diesem Buch beschäftige, gehören zu unserer näheren Verwandftschaft. Das ist eine Tatsache. Wenn unsere Gefühle etwas anderes sagen, liegt das daran, dass sie von Biologie keine Ahnung haben.“

Was gelegentlich etwas nervt, sind die klassischen Natur/Kultur-Stereotype. Der Fuchs ist scharfsinnig und anpassungsfähig, der Mensch hingegen kommt nichtmal mal vom Sofa hoch – ein kulturpessimistischer Dualismus, der die Kluft zwischen Natur und Kultur wieder aufreißt, sich an vielen weiteren Stellen im Buch auftut und mir immer etwas unangenehm aufstösst. Immer wieder wird der keim- und leidenschaftsfreie Großstadtbürger der wilden, freien Natur gegenübergestellt. In den meisten Fällen bekommt Foster aber noch die Kurve, bevor er ganz in romantisierte Wildheitssehnsucht verfällt – auch wenn es manchmal knapp ist.
Der Geschmack von Laub und Erde
Charles Foster
Piper Verlag
ISBN: 978-3-89029-262-5
Preis: 20,00 €